
Antworten auf häufige Fragen zur Forschung mit Tieren und Menschen finden Sie in den Themendossiers «Tierversuche in der Schweiz (FAQ)» und «Forschung mit Menschen (FAQ)».
Neurobiologen der ETH und Universität Zürich reichen beim kantonalen Veterinäramt ein Gesuch zur Durchführung von Tierversuchen ein. An sich wäre das nichts Aussergewöhnliches, würde es sich bei den Versuchstieren nicht um Makaken handeln und wäre da nicht der Umstand, dass an Zürcher Hochschulen seit Jahren keine invasiven Versuche an Primaten mehr durchgeführt wurden.
Als der Tagesanzeiger am Freitag der letzten Woche über die Versuche berichtete, blieben die negativen Kommentare und die Proteste von Tierschutzorganisationen erwartungsgemäss nicht aus. Und trotzdem erstaunt die Heftigkeit der Reaktion.
Ein wenig mehr Konsequenz, bitte
Die Schweiz hat eines der schärfsten Tierschutzgesetze der Welt. Besonders hoch sind die gesetzgeberischen Hürden bei Versuchen an Affen: 2013 betrug der Anteil bewilligter Primatenversuche gerade einmal 0.5 Promille aller Tierversuche, wobei es sich in über der Hälfte der Fälle um Verhaltensexperimente ohne Belastungen für die Tiere handelte.
Trotzdem stellen sich schwierige Fragen in Bezug auf die ethische Vertretbarkeit solcher Eingriffe. Eine öffentliche Diskussion darüber hat also durchaus ihre Berechtigung. Empörung allein reicht als Grundlage aber nicht aus; vielmehr müssen die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sein, wenn wir einen seriösen Diskurs führen wollen:
Erstens sollten wir uns darüber klar werden, was wir von der Wissenschaft erwarten dürfen und welche Voraussetzungen es braucht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Davon hängt auch die ganz grundsätzliche Frage ab, welchen Stellenwert wir der Forschung im Allgemeinen und der Grundlagenforschung im Speziellen zuweisen.
Zweitens müssten konsequenterweise all jene, welche für ein Verbot von Affenversuchen in der Schweiz plädieren, auch auf Medikamente und Behandlungsmethoden verzichten, welche dank Primatenexperimenten im Ausland entstehen. Alles andere wäre heuchlerisch.
Drittens sollten wir nicht nur über tierexperimentelle Forschung reden, sondern allgemein unseren Umgang mit Tieren hinterfragen. Denn die meisten Tiere sterben nicht im Namen der Wissenschaft, sondern um unseren Hunger nach Fleisch zu stillen.
Der Nutzen von Grundlagenforschung
In der Debatte um Tierversuche wird gerne eine künstliche Trennlinie gezogen zwischen angewandter Forschung einerseits und Grundlagenforschung andererseits. Angewandte Forschung, so sagt man sich, bringe dem Menschen einen direkten Nutzen – also nimmt man auch das Leid der Versuchstiere in Kauf. „Praxisrelevanz“ lautet das Schlagwort. Aber „praxisrelevante Forschung“ ohne Grundlagenforschung ist wie Kochen ohne Zutaten oder Schriftstellerei ohne Kenntnisse des Alphabets – absurd.
Wer einen Roman schreiben möchte, der muss schliesslich auch zuerst die einzelnen Buchstaben kennen, dann diese Buchstaben zu Wörtern, Wörter zu Sätzen, Sätze zu Seiten und Seiten zu einem Buch formen. Und als Goethe in der Schule Lesen und Schreiben lernte, wusste er auch noch nicht, dass er mit diesen Werkzeugen einmal den Faust erschaffen würde.
Natürlich: Genauso wenig, wie jeder Schüler zum Schiller wird, führt jedes Experiment zur Entwicklung eines neuen Medikaments. Wir dürfen deshalb nicht erwarten, dass jeder einzelne Tierversuch einen direkten Nutzen für den Menschen erbringt. Trotzdem ist er nicht nutzlos, stellt er doch das Wissen, die Werkzeuge bereit, die wir zur Entwicklung eben solcher Medikamente brauchen.
Ein Beispiel aus der Geschichte der Hirnforschung soll zeigen, was damit gemeint ist: In den 60er- und 70er-Jahren führten die beiden Wissenschaftler David Hubel und Torsten Wiesel Versuche an Katzen und Affen durch, welche unser Verständnis von der Funktionsweise des Sehens grundlegend verändert haben. Dank ihnen wissen wir, dass unser Hirn über eine Art innere Karte verfügt, auf der visuelle Informationen aus unserer Umwelt abgebildet und aufgeschlüsselt werden. Sie haben uns zudem gezeigt, dass diese Karte zwar in ihren Grundzügen schon von Geburt an besteht, aber für eine normale Entwicklung auf visuelle Reize in der frühen Kindheit angewiesen ist. Zusammen mit Roger Sperry, einem Hirnforscher, der unter anderem das Zusammenspiel der beiden Hirnhälften untersuchte, erhielten Hubel und Wiesel 1981 den Nobelpreis in Physiologie und Medizin.
Die Tätigkeit der drei Wissenschaftler war Grundlagenforschung in Reinkultur. Ihre Arbeit hat unser Verständnis des Gehirns einen enormen Schritt vorangebracht und ihre Erkenntnisse sind Teil jeder Einführungsvorlesung und jedes Lehrbuchs der Neurobiologie.
Nach heutigen Massstäben würde diese Forschung wohl trotzdem als „zu wenig praxisrelevant“ beurteilt. Sie müssten sich bei einem Antrag auf Bewilligung ihrer Versuche höchstwahrscheinlich den Vorwurf gefallen lassen, dass daraus auf den ersten Blick keine direkten klinischen Erkenntnisse ableitbar seien.
Dabei liegt die Bedeutung ihrer Arbeit nicht primär im direkten Nutzen für die Medizin (den es durchaus gab), sondern im Wissen, das wir dank ihnen über grundlegende Funktionen unseres Gehirns gewonnen haben und das nun dazu genutzt werden kann, den Geheimnissen unseres Denkorgans weiter auf den Grund zu gehen.
Wissenschaft ist nicht linear, im Gegenteil: Wissenschaftliche Forschung ist ein langer und beschwerlicher Lernprozess, der vom beständigen Austausch innerhalb einer Fachrichtung und zwischen den Disziplinen lebt. Es ist ein steiniger Weg von der ersten Erkenntnis im Labor bis zu Behandlung im Krankenhaus und ein klinischer Versuch ist nur die Spitze eines wissenschaftlichen Eisberges. Das Wissen, welches klinischen Forschern erlaubt, ihre Hypothesen zu testen und neue Therapien zu entwickeln, baut auf der Arbeit von unzähligen anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf, die Versuche in Zellkulturen, Reagenzgläsern, Computersimulationen und eben auch an Tieren durchgeführt haben.
Denn medizinische Wunder gibt es nicht. Solange in unserer Gesellschaft der Wunsch nach neuen Therapiemethoden und neuen Medikamenten besteht, können wir nur mit Hilfe der Wissenschaft nach Lösungen suchen. Dazu gehören klinische Studien ebenso wie Experimente der Grundlagenforschung. Wir können nicht zum Mond fliegen, ohne uns vorher über die Gesetze der Schwerkraft im Klaren zu sein und genauso wenig können wir Alzheimer heilen, wenn wir unser Gehirn nicht verstehen.
Was wir aus Affenversuchen lernen können
Selbstverständlich dürfen wir uns als Gesellschaft trotzdem für ein Verbot von Affenversuchen aussprechen – und sei der Nutzen für die Forschung noch so gross. Wenn deswegen aber immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ins Ausland ausweichen ins Ausland ausweichen, sollten wir dann nicht auch auf allfällige Therapien verzichten, welche dort dank Affenexperimenten entwickelt werden? Wer von uns wäre in einer Notsituation tatsächlich dazu bereit?
Dass dies keine hypothetische Frage ist, zeigt die lange Liste der Erfolge biomedizinischer Forschung an Affen. Ihre grosse Ähnlichkeit zu uns Menschen ist gerade in der Neurobiologie von grosser Bedeutung und hat uns schon mehrmals den Weg zu neuen Medikamenten und Behandlungsmethoden gewiesen.
Erstes Beispiel – Polio: Bis zur Entwicklung eines Impfstoffes im Verlaufe der 50er- und 60er-Jahre war Kinderlähmung (Polio) eine weltweit verbreitete Nervenkrankheit, die jährlich zehntausende von Kindern tötete oder zu Lähmungen ganzer Gliedmassen führte. 1988, vor der globalen WHO-Impfkampagne, erkrankten noch 350‘000 Kinder jährlich an Polio. Bis 2013 konnte diese Zahl auf gut 400 reduziert werden und die Ausrottung der Krankheit scheint in Reichweite. Zur Entwicklung dieses Impfstoffes wurden auch zahlreiche Versuche an Affen durchgeführt.
Zweites Beispiel – Parkinson: Ende der 80er- und zu Beginn der 90er-Jahre konnte in einer Reihe von Experimenten an Affen und Menschen nachgewiesen werden, dass die Stimulation bestimmter Hirnareale dabei helfen kann, Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen zu beheben, wie sie oftmals bei Parkinsonpatienten vorkommen. Heute kommt die sogenannte „Tiefenhirnstimulation“ routinemässig zum Einsatz – mit sehr guten Ergebnissen. Das Verfahren ist bei Menschen ähnlich wie bei Makaken: Elektroden, die permanent ins Hirn eingesetzt werden, geben leichte Stromstösse ab, welche dabei helfen, das bei Parkinson typische Zittern zu stoppen und die Verlangsamung der Bewegungen rückgängig zu machen.
Drittes und viertes Beispiel– Schlaganfall und Querschnittlähmung: Das sogenannte „Contrained Induced Movement“-Training hat seinen Ursprung ebenfalls in Versuchen an Makaken. Es stellt eine Therapie zur Behandlung von Schlaganfallpatienten dar, bei der die Betroffenen angeregt werden, die vom Anfall geschädigte Körperseite verstärkt zu benutzen, um die Regeneration zu fördern. Und Experimente an Makaken könnten dereinst auch bei Querschnittlähmungen den Weg zu einer neuen Therapie weisen. Experimente, notabene, die in der Schweiz durchgeführt werden.
Diese Liste liesse sich noch weiterführen, kommen Affen doch nicht nur in der Neurobiologie, sondern auch bei der Erforschung zahlreicher anderer Krankheiten zum Einsatz. Allein Makaken dienen als Modell für mehr als 70 verschiedene menschliche Infektionskrankheiten und bei der Entwicklung des HIV-Medikaments „Tenofovir/PMPA“ sowie bei der verzweifelten Suche nach einem Ebola-Impfstoff wurden bzw. werden ebenfalls Experimente an Makaken durchgeführt.
Affenexperimente finden sich überdies auch hinter Forschungsprojekten, die auf den ersten Blick als mögliche Alternativen zu Tierversuchen erscheinen. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Human Brain Project. Unter der Führung der EPF Lausanne wagen sich Forschende aus ganz Europa an das ehrgeizige Unterfangen, das menschliche Hirn im Computer zu simulieren. Obwohl viele das Milliardenprojekt als Möglichkeit zur Reduktion von Tierversuchen ansehen, sind auch hier zahlreiche Experimente an verschiedenen Tieren vorgesehen – inklusive Makaken.
Mit gleichen Ellen messen – Tierversuche und Fleischkonsum im Vergleich
Trotz der grossen Bedeutung von Tierversuchen für Wissenschaft und Medizin sprechen sich laut einer Umfrage des Schweizerischen Tierschutzes 40% der Bevölkerung gegen Experimente an Tieren aus. Derweil sind aber nur 3% der Schweizerinnen und Schweizer Vegetarier und gerade einmal 0.3% haben sich dem Veganismus verschrieben. Das lässt nur einen Schluss zu: Die überwiegende Mehrheit der Tierversuchsgegner sieht kein Problem darin, ein Filet zu geniessen, zeigt sich jedoch empört darüber, dass in der Wissenschaft Tiere zu Versuchszwecken eingesetzt werden.
Das ist inkonsequent vor allem wenn wir die folgenden Zahlen betrachten: Von 2003 bis 2012 stieg die Anzahl Schlachttiere von 46 Millionen auf 61 Millionen. Auf der anderen Seite sank die Zahl der in der Schweiz verwendeten Versuchstiere von fast zwei Millionen Anfang der 80er-Jahre auf 600‘000 im Jahr 2012. Dabei entsprachen 41% der Experimente dem Schweregrad 0 und 37% dem Schweregrad 1. Bei Versuchen von Schweregrad 0 erfahren die Tiere keine Schmerzen, während Schweregrad 1 bedeutet, dass die Tiere kurzfristige, leichte Belastungen ertragen müssen. Darunter fällt beispielsweise die Kastration von männlichen Tieren unter Narkose; eine Praxis, die in der Schweizer Landwirtschaft bis vor wenigen Jahren routinemässig an Ferkeln durchgeführt wurde – jedoch ohne Betäubung.
Berücksichtigt man also nur die mittel- bis schwerbelastenden Tierversuche der Schweregrade 2 (20%) und 3 (2%), dann wirkt das Ungleichgewicht noch viel erdrückender: Auf jedes einzelne Versuchstier, das sich einem belastenden Experiment unterziehen muss, kommen 460 Hühner, Rinder, Schweine, Pferde, Ziegen und Schafe, die in unseren Mägen landen. Dabei stehen diese Tiere ihren Verwandten in der Wissenschaft an Intelligenz, Sozialverhalten und Schmerzempfinden in nichts nach. Und auch wenn ich mir das lange selbst nicht eingestehen wollte: Schlachttiere leiden durchaus, denn die Fehlerquote bei der Betäubung ist verhältnismässig hoch.
Ich kritisiere niemanden dafür, dass er gerne ein Stück Fleisch auf dem Teller hat. Aber es leuchtet mir nicht ein, warum das Töten von Tieren für den Genuss legitimer sein soll als der Einsatz von Tieren zum Zwecke der Wissenschaft. wieso räumen wir dem persönlichen Gaumenspass einen höheren Stellenwert ein als der Erforschung unseres Gehirns? Was macht den Verzehr einer Hühnerbrust ethisch vertretbarer als die Suche nach einem Medikament gegen Alzheimer? Und wieso muss die Wissenschaft viel schärfere Vorschriften befolgen als die Landwirtschaft, wenn es um Tiere geht?
Unseren Fleischkonsum könnten wir ohne Probleme reduzieren. Die biomedizinische Forschung ist jedoch nach wie vor auf Tierversuche angewiesen und voraussichtlich wird sich das auch nicht so bald ändern. Wenn wir aber alle tierethischen Probleme auf die Forschung überwälzen, während wir der Frage nach dem persönlichen Verzicht geschickt ausweichen, dann ist damit niemandem geholfen – ausser vielleicht unserem Gewissen.
Der Text ist in einer gekürzten Fassung am 1. Oktober 2014 im Politblog des Tages-Anzeigers erschienen. Zum Artikel
Die Beiträge auf dem Reatch-Blog geben die persönliche Meinung der Autor*innen wieder und entsprechen nicht zwingend derjenigen von Reatch oder seiner Mitglieder.

















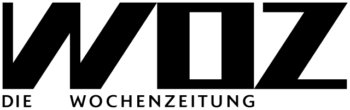




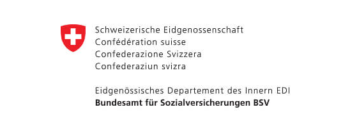












Comments (0)